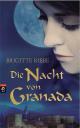cbj
ISBN 978-3570136805
historischer Roman, Thriller, Liebesgeschichte, Jugendbuch ab 12 Jahre
Originalausgabe 2010
Umschlaggestaltung Geviert Büro für Kommunikationsdesign
Gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag, 400 Seiten
15,99 [D]
Die 1953 in München geborene Brigitte Riebe studierte Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte, ist promovierte Historikerin und arbeitete als Museumspädagogin und später als Verlagslektorin bei Bertelsmann. Diese Stelle gab sie 1991 zugunsten einer Tätigkeit als freie Schriftstellerin auf. Genre übergreifend schrieb sie seither etwa 30 Romane. Sie ist über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt, da ihre Romane in über acht Sprachen übersetzt wurden.
In den 1990er Jahren verfasste Griebe moderne Gesellschaftsromane. Darüber hinaus erschien bei Goldmann 1992 der erste Band einer letztlich achtbändigen Krimireihe um die Juristin und Antiheldin Sina Teufel. Diesen und die folgenden sieben Bände verfasste die Autorin jedoch unter dem Pseudonym Sara Stern. Im achten Roman der Krimireihe verabschiedete sich Riebe/Stern von ihrer Hauptfigur. Einer der Bände wurde Mitte der 1990er Jahre unter anderem mit Rufus Beck unter dem Titel Inzest filmisch in Szene gesetzt.
Während in den 1990ern neben ihren modernen Gesellschaftsromanen nur zwei historische Romane erschienen, verlagerte sich der Schwerpunkt ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ab 2000 eindeutig auf den historischen Roman. Seither erschienen 11 weitere Romane mit dieser Thematik, wovon zwei als Jugendbücher verlegt wurden. Eines davon möchte ich heute vorstellen.
Geht man auf die Verlagsseite, erfährt man Folgendes über den Inhalt:
Packender Thriller und mitreißende Liebesgeschichte
Granada 1499: Die 16-jährige Lucia, Tochter des Goldschmieds Antonio, ist seit ihrer Kindheit eng befreundet mit Nuri, der Tochter des Steinschleifers Kamal. Und verliebt in Rashid, Nuris Bruder. Eine solche Verbindung wird jedoch undenkbar: Nach der Vertreibung der Juden richtet sich das spanische Königspaar nun gegen die Mauren, die in Granada jahrhundertelang friedlich mit Juden und Christen zusammengelebt haben. Kamal gerät in die Fänge der Inquisition, die ihre Fühler auch nach Antonio ausstreckt. Lucia ist verzweifelt. Da tritt Miguel auf den Plan, ein junger Steinschleifer, der Lucias Gefühle heftig durcheinanderbringt
Diese Geschichte ist auf 358 Seiten verteilt in Worte umgesetzt, gebunden und mit einem Schutzumschlag versehen worden, der durch das ruhige Gesicht vor der mondbeschienenen Kulisse Granadas schlicht aber schön wirkt. Das Buch soll für LeserInnen ab 12 Jahren sein. Ein Nachwort, in dem die Autorin auf die damalige Zeit und einen Bezug zum Dritten Reich eingeht, füllt zusammen mit einem Anhang aus alphabetisch sortierten Begriffserklärungen die restlichen Seiten.
Nicht zum ersten Mal streckte die Autorin also ihre Recherchefühler in die Vergangenheit aus. Dieses Mal entführt sie LeserInnen in die Zeit der erzwungenen Christianisierung Granadas. Einer Stadt, in der muslimische Mauren viele Jahrhunderte als Herrscher in friedvoller Gemeinschaft mit den beiden anderen großen Religionen (Christentum und Judentum) lebten. Ein Leben, in dem Kultur und Wissen einen hohen Stellenwert hatten. Ein Leben, in dem Freundschaften entstanden, die Familienverhältnissen glichen und in dem sich lange Zeit niemand an der Andersartigkeit der Glaubensrichtungen störte. Sie nicht nur tolerierte, sondern mit lebte.
Doch all das hat ein Ende, als, kurz nachdem die Juden erfolgreich ausgegrenzt und gejagt wurden, auch die Mauren dazu gezwungen werden, den christlichen Glauben anzunehmen oder zu fliehen, wenn sie dem Tod entgehen wollen. Ein sehr düsteres Kapitel in der Kirchengeschichte, der Geschichte des spanischen Königshauses, der Menschheit überhaupt. Ein Kapitel, das deutlich vor Augen führt, was im Namen des Glaubens alles angerichtet wurde und bedauerlicherweise immer noch wird. Riebes Roman stimmt nachdenklich, wirft die Frage auf, wie das Verhältnis der Weltreligionen untereinander heute wohl sein könnte, wenn damals nicht aus Machtgier und künstlich heraufbeschworenem Hass unter dem Deckmantel des Glaubens so viel zerstört worden wäre.
Diese gewaltsame Christianisierung, die mit verständlicher Gegengewalt vonseiten aufständischer Muslime beantwortet wird, ist einer der Themenstränge in Riebes Geschichte. Eng verbunden damit ist der Zweite, der die Aufklärung eines Diebstahls betrifft, und wiederum mit dem Dritten, einer religionsübergreifenden Liebesgeschichten verknüpft ist.
Diese Grundgedanken an sich haben mir gefallen, allerdings empfand ich sowohl die einzelnen Charaktere als auch die Handlungsstränge stellenweise zu flach. Es mag sein, dass das an meinem Alter liegt, das nicht mehr der Zielgruppe (ab 12 Jahren) entspricht. Allerdings habe ich mit der Freigabe für diese Zielgruppe auch so meine Probleme. Warum? Nun das Buch ist zum einen angenehme Alternative zu den derzeit auf den Markt befindlichen Fantasygeschichten für junge LeserInnen, vermittelt nachvollziehbar historische Begebenheiten und ergeht sich trotz der darin beschriebenen Brutalität nicht in Gewaltorgien. Auch die Sexualität wird nicht als verkaufsförderndes Element mit einbezogen. Dennoch würde ich persönlich es meinen Nichten in dem Alter noch nicht geben, wobei ich auch denke, dass diese ganz leichte Probleme mit dem Sprachgebrauch der Autorin hätten. Ihre Sprache ist einfach, wirkt aber bisweilen fast melodramatisch und lässt dann wiederum an Tiefe vermissen.
Die, laut Klappentext, mitreißende Liebesgeschichte von Lucia und Rashid ist leider nicht wirklich tief gehend beschrieben. Sie enthält romantische Momente, geht aber genau genommen fast verloren. Fast gleichwertig scheint die Beziehung der muslimischen Haushälterin und Geliebten zu Lucias Vater. Auch die zarten, sich zwischen Nuri und Miguel anbahnenden Bande, verblassen in ihrer Andeutung und werden für mich nicht ausreichend beleuchtet, gehen fast unter gegenüber der Erwähnung der Gefühle, die ein befreundeter Priester für Lucias Tante empfindet. Selbst unter Berücksichtigung dessen, dass die Liebesgeschichte ja hauptsächlich um Lucia und Rashid gehen soll, wobei Lucias Gefühle wegen Miguel durcheinandergeraten, gewinnt dieser Strang nicht an Faszination. Daneben erscheint sowohl die Aufklärung des Diebstahls als auch der Part, der an dieser Stelle eingreifenden Inquisition, zu eindimensional und vorhersehbar dargestellt.
Gelohnt hat es sich für mich trotzdem, das Buch zu lesen. Denn der erstgenannte Handlungsstrang rettet Riebes Geschichte. Die Nacht von Granada ist nicht nur der Titel des Buches, sondern auch der Gipfel dessen, was damals passierte. Die unnötige und berechnende Vernichtung von Wissen und Kulturschätzen durch den Erlass der Verbrennung aller arabischen Schriften, die damals zu wochenlangen Aufständen führte. Riebes Beschreibung des Vertrauensbruchs, den die Kirche und spanische Krone durch die Missachtung des Übergabevertrages der Stadt von den bisherigen an die neuen Machthaber begangen hat, ist sehr gut gelungen. Ebenso die Schilderung der erzwungenen Taufen und der Diskriminierungen, die die maurische Bevölkerung ertragen musste. Ihre den Umstand beschreibenden Worte, dass Angst vor einer ungewissen Zukunft Stimmungen weckt, die massenhysterische Züge annehmen können, sind nachvollziehbar echt gewählt. Da auch die Tatsache, dass es schon immer in allen Glaubensgemeinschaften Menschen gegeben hat, die ihren Glauben gelebt und nicht missbraucht haben, nicht zu kurz kommt, gefiel mir der für mich eigentliche Hauptstrang gut.
Fazit
Vielleicht ist es etwas weit hergeholt, aber historische Romane wie Die Nacht von Granada können mit dazu beitragen, dass es ein besseres Verständnis zwischen den Religionen geben kann. Das ist leider auch in der heutigen Zeit noch ein nach wie vor aktuelles Thema. Und damit wird das Buch, trotz anfänglicher Bedenken, dann doch wieder etwas für junge LeserInnen. Und ältere Fans historischer Romane kommen auch nicht zu kurz.
Copyright © 2010 by Antje Jürgens (AJ)