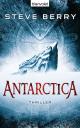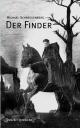periplaneta
ISBN 9783940767639
ISBN 3940767638
Fantasy
1. Auflage 2011
Taschenbuch, 222 Seiten
[D] 13,00
Verlagsseite
Autorenseite
Der 1986 im damaligen West-Berlin geborene Autor veröffentlichte sein erstes Buch Yuma 23 2007 als kostenloses E-Book, 2008 erschien bei BOD Die Rückkehr der Phoenix. Im Jahr 2009 begann der in Schleswig-Holstein lebende Informatiker mit der Arbeit an Der rote Ozean. Zwölf Monate später stand die Rohfassung des 2011 von periplaneta veröffentlichten Romans. Da Klapschus der westlichen Wertegesellschaft nach eigenen Aussagen kritisch gegenübersteht, handelt Der rote Ozean von einem Glaubenskrieg der zu einem Endzeitszenario führt. Der Autor hat seine Geschichte ins Jahr 2027 verlegt und bietet ihr einen Zeitrahmen bis Anfang 2030, bevor er im letzten Kapitel einige Jahre weiterspringt. Die Handlungsorte sind der Nahe Osten, mit Israel und dem Libanon, sowie die Ostküste der Vereinigten Staaten. Die Orte könnten teilweise beliebig getauscht werden, die Geschichte selbst jedoch ohne Weiteres auch im hier und jetzt spielen, da er keine technischen Fortschritte oder Neuerungen beschreibt.
Die Dystopie mit fantastischen Elementen handelt von Brian. Einem jungen Amerikaner mit libanesischen Wurzeln, der mit seinen Eltern aus den Staaten in den Nahen Osten gezogen ist. In der Familie gibt es Muslime wie Christen und Klapschus streift kurz das, was die Menschen in dieser Region tatsächlich teilweise leben religionsübergreifende Beziehungen trotz aller politischen und religiösen Schwierigkeiten. Doch all das endet, als ein seltsames Wesen einen gewaltsamen Tod findet, das von beiden Seiten als göttlich anerkannt und für sich beansprucht wird. Schuldzuweisungen führen zu einem unerbittlichen Krieg. Was in der Realität bereits seit Jahrhunderten immer wieder im Kleineren aufflammt, wird hier bis zur bitteren Neige ausgetragen und bekommt noch eine neue Dimension. Denn zeitgleich beginnt sich der Ozean blutrot zu verfärben. Der Regen, der vom Himmel fällt, ist genauso gefärbt. Wasser schmeckt nicht mehr wie Wasser und ganze Kontinente versinken unaufhörlich in der nicht aufzuhaltenden roten Flut. Die Covergestaltung passt in ihrer eher minimalistischen Art sehr gut. Es zeigt auf einem Felsen in einem blutroten Meer einen zusammengekauerten Engel, dessen erhobene Flügel (genau wie die Schrift) von einem blutigen Regen durchnässt werden.
Obwohl Klapschus einen relativ einfachen Schreibstil erkennen lässt und seinen Roman in kurze Kapitel teilt, was dazu führt, dass man die Geschichte in einem Rutsch durchlesen kann, macht er es dem Leser gleichzeitig nicht ganz einfach, an Der rote Ozean dran zu bleiben. Er bedient sich einiger Klischees und bleibt in seinen Beschreibungen nicht wirklich durchgehend logisch oder konsequent. Passend zu den dystopischen Elementen sind seine Figuren blass. Einzig sein christlich getaufter Hauptcharakter Brian, mit dem er wenig zartfühlend umgeht und aus dessen Sicht (wenn auch nicht von ihm) Der rote Ozean erzählt wird, wird etwas klarer herausgearbeitet. Doch wirkt er wenig sympathisch, oft mürrisch, feige und stellenweise geradezu fatalistisch stupide. Er ist neben der jungen Muslima Khayra anscheinend der Einzige, der einen nuklearen Angriff auf Beirut unverletzt überstanden hat und gilt als eine Art Erlöser der Menschheit, ist aber definitiv kein Held.
Ich kann nicht behaupten, dass das Buch ganz schlecht ist, dafür ist allein die Grundidee viel zu gut. Auch der Engel der Brian ab dem Angriff auf Beirut immer wieder besucht, hat mir gefallen. Dasselbe gilt für das Ende, das sich im Kapitel 62 auf etwas mehr als einer Seite findet. Ich würde zu viel verraten, wenn ich jetzt explizit darauf eingehe, was dort vorkommt. Es scheint mir jedoch der einzig logische und vor allem richtige Schluss für viele Probleme, die die Erde derzeit hat. Ebenfalls passend fand ich, dass der Autor trotz des Religionskrieges keine missionarisch wirkende Partei für Muslime oder Christen ergreift, sondern den Fokus hier eindeutig auf den zerstörerischen Fanatismus richtet.
Doch es gibt zu viele Tatsachen, mit denen man einfach ohne weitere Erklärung konfrontiert wird, die jedoch dringend einer solchen bedurft hätten. Es gibt zu viele Wenn und Aber in der Geschichte. Zu viele glückliche Zufälle, die Brian betreffen. Vieles mag in der künstlerischen Freiheit begründet liegen, alles lässt sich damit jedoch nicht begründen. Obwohl Klapschus es geschafft hat, die geringe Lernfähigkeit der Menschheit beziehungsweise deren religionsübergreifende Verbohrtheit zu vermitteln, gibt es zu viel Störendes, als dass mich Der rote Ozean wirklich begeistert hätte. Nicht alles muss in einem Roman der beiden Genres (Dystopie/Fantasy) zwingend logisch sein. Möglicherweise wäre es sinnvoll gewesen, aus dem jetzt vorliegenden Roman eine allenfalls 100seitige Novelle zu machen oder ihn um mindestens 400 Seiten auszubauen. Dann hätte vermutlich die Chance bestanden, ihn so packend zu formulieren, wie die Idee es verdient. Wer die Geschichte unvoreingenommen lesen möchte, sollte den Rest meiner Buchbesprechung auf keinen Fall lesen, denn darin möchte ich ein paar Beispiele aufführen.
Beginnen möchte ich mit dem Wesen, das gleich zu Anfang des Romans auftaucht und umkommt. Völlig unabhängig davon, dass Brian den Vorfall, bei dem er zugegen ist, unsinnigerweise eher als Anschlag auf sein Leben bezeichnet, wundert sich niemand wirklich über das Wesen an sich. So etwas gab es anscheinend vorher noch nicht. Obwohl Menschen vor Ort waren, gibt es keine wirklichen Zeugen. Es gibt mageres Bildmaterial, aber genau genommen weiß niemand, was dort wirklich passiert ist. Das hindert Muslime wie Christen jedoch nicht daran, das unbekannte, sich wieder ins Nichts auflösende Wesen aufgrund eines einzigen, gesprochenen Satzes sofort als göttlich zu erkennen, für sich zu beanspruchen und den mehr als vage beschriebenen Mord auf grausamste Weise zu rächen.
Kurz darauf findet ein Attentat statt. Für dieses soll laut Regierung der christlichen Welt die sich Christliche Föderation nennt Khayras Vater verantwortlich sein. Der soll eine Hochzeitsgesellschaft samt Gebäude in die Luft gesprengt haben und damit für Brian, der mit seiner Familie eben neben Khayra und ihrer Familie dort anwesend war, der Mann sein, der den Tod seiner Familie verschuldet hat. Beirut wird im gleichen Augenblick mit Nuklearwaffen verwüstet und atomar verseucht. Oder war es doch Khayras Vater, der eine Atombombe gezündet hat? Wenn ja, scheint es fraglich, dass er das überlebt hat. Genauso wie es fraglich scheint, dass ausgerechnet er den eventuell doch eher kriegerisch erfolgten Gegenschlag zu dem angeblich auf das Wesen verübte Attentat überlebt hat. Das soll er aber laut Aussage der Christlichen Föderation, denn Brian wird nach seiner Ausbildung auf ihn angesetzt und soll ihn töten und will es auch tun, damit seine Familie gerächt ist. Ein Selbstmordattentat wäre tatsächlich nachvollziehbar gewesen, denn so etwas ist genau wie Fanatiker im Allgemeinen leider viel zu oft traurige Realität. Doch auf den Gedanken, dass Brians Familie auch durch den nuklearen Angriff ums Leben gekommen wäre und Brian auch gar nicht unterscheiden konnte, was denn nun zuerst erfolgte, kommt der Junge nach seiner Ausbildung nicht. Da erscheint es fast nebensächlich, dass Brian sofort erkennt, dass eine Atombombe gezündet wurde und er sich deshalb logischerweise vor Strahlung fürchtet. Aus dem Grund verzichtet er darauf, aus seinem praktischerweise wiedergefundenen Zuhause Nahrungsmittel mitzunehmen. Die gleichermaßen verstrahlten Decken oder Kleidung scheinen ihm jedoch absolut kein Kopfzerbrechen zu bereiten.
Es könnte natürlich daran liegen, dass der Autor, die Geschichte ins Jahr 2027 verpflanzt hat und er gedanklich davon ausgeht, dass in dieser Zukunft sogar in absoluten Katastrophenszenarien alles bis ins Kleinste weltweit überwacht wird. Die Herscharen von Mitarbeiten, die ein solches Überwachungssystem tragen, könnten durchaus im schriftstellerisch möglichen Bereich liegen. Ob diese Vermutung stimmt, ist jedoch offen. Denn leider bringt Klapschus das dem Leser zuvor nicht nahe und so scheint es wenig nachvollziehbar oder gar glaubwürdig, dass die Armee der Vereinigten Staaten Brian in dem radioaktiv verstrahlten, völlig verwüsteten Stück Land nur kurz nach dem Angriff findet, in die Staaten bringt und ihn als Soldat für den Glaubenskrieg ausbildet. Das alles übrigens, während zeitgleich die komplette Westküste der Vereinigten Staaten untergeht und dort Millionen von Menschen ein blutrotes und nasses Grab finden.
Ähnlich schwer nachvollziehbare Geschehnisse häufen sich. Liegt es an Streichungen? An Textpassagen, die der Überarbeitung zum Opfer fielen, das so vieles einfach als hinzunehmende Tatsache präsentiert wird? Dinge wie der Verlust von Brians Unterschenkels gegen Ende der Geschichte deuten fast darauf hin, denn mit dieser Tatsache wird man genau wie mit vielen anderen einfach konfrontiert, während anderes ausgeschmückt wird, das wenig aussagekräftig scheint.
Oder nehmen wir Khayra. Ihre Wandlung vom unschuldigen Teenager in eine Soldatin beziehungsweise Attentäterin bekommt man kaum mit. Die Wandlung an sich wäre nachvollziehbar. Was jedoch wenig authentisch wirkt, ist ihre Vorgehensweise bei den beiden Attentaten im Roman. Beide finden im Hoheitsgebiet der Christlichen Föderation statt. Bei dem, was Khayra vorhat, sollte man meinen, dass sie so lange wie möglich unsichtbar und angepasst an ihre Umgebung vorgeht, um ihre Mission zu erfüllen. Das tut sie aber nicht. Statt dessen hüllt sie sich in einem Land, das unerbittlich gegen Muslime vorgeht, in einen Tschador. Zieht das eine Mal zwar anscheinend feindselige Blicke auf sich, schafft es beide Male aber problemlos nicht nur den Sprengstoff, sondern auch sich selbst durch sämtliche Reihen und Sperren zu manövrieren. Diese Sache lässt sich nicht nur mit den Strukturen erklären, die zwangsläufig kollabiert sein müssen, sondern wirkt einfach nur wie ein Klischee.
Völlig unabhängig davon ist da noch die alles verschlingende blutrote Flut. 2012-gleich schaffen die Überlebenden beider Religionen es im Geheimen Archen zu bauen, die einen kleinen Teil der Bevölkerung retten können. Klingt logisch, wie sollte man sonst überleben, wenn die Erde versinkt. Was weniger logisch ist, ist die Frage, wie das geklappt haben soll. Innerhalb weniger Monate geht Klapschus Erde sprichwörtlich unter. Abgesehen von Hunderten von Millionen Toten durch die Flut dürften auch die Zerstörungen und Toten durch die kriegerische Auseinandersetzung dazu führen, dass jegliche Infrastruktur weltweit komplett zusammenbricht. Trotzdem werden die Archen pünktlich fertig. Trotzdem kommen Briefe (von Khayra an Brian und umgekehrt, wenn auch mit einiger Zeitverzögerung) an, was wiederum dem aus Verständnisgründen angenommenen Überwachungsszenario widerspricht. Trotzdem findet sich genügend Benzin und Kerosin, dass Khayra mal eben vom Nahen Osten nach Amerika fliegen und Brian mal eben mit einem Auto zu einem Café kommen können, wo sie, tief verhüllt, alles in Schutt und Asche legt bis auf Brian und sich selbst.
Weil sie ihn liebt und hasst? Das in der Inhaltsangabe stehende In diesem Chaos begegnen sich Brian und Khayra, die sich lieben und hassen lernen
. kann nicht überzeugen, sondern ist eine weiterer Punkt, der einfach behauptet wird. Am sich lieben lernen kann man als Leser nicht teilnehmen, da ihre gemeinsame Zeit, sich auf eher nichtssagende Minimalstbegegnungen beschränkt. Sie sprechen kaum miteinander und für Liebe auf den ersten Blick ist der angebliche Hass zu krass. Der wiederum ist hauptsächlich durch ein paar wenige Sätze von Leuten begründet, die ihnen einreden, dass die jeweils andere Religion an allem schuld und deren Vernichtung der einzige Weg ist, vor der roten Flut gerettet zu werden. Selbst Jugendliche und als solche lernen wir Khayra und Brian zumindest flüchtig kennen (sie ist zu Beginn 15, er ein Jahr älter) – lassen mehr eigenständiges Denken erwarten, als die beiden trotz und Brian auch schon vor dem Trauma in Beirut erkennen lassen. Gleichwohl ist der angebliche Hass zwischen den beiden auch gar nicht vorhanden. Sie tötet ihn nicht, trotz passender Gelegenheit, rettet ihn quasi sogar mehr als einmal. Und auch er trägt mehr oder weniger einmal dazu bei, dass sie überlebt.
Das Wie und Warum, die angebliche Motivation für bestimmte Handlungen aller wird nicht erklärt und erscheint zum Teil mühsam konstruiert. Außerdem scheinen der Libanon und der Rest der Vereinigten Staaten trotz des riesigen Meeres dazwischen plötzlich sehr nah beisammen. Immerhin starten die Kampfjets an der Ostküste problemlos in ihren Einsatz im Nahen Osten. Direkt über einen Trupp in Ausbildung befindlicher Soldaten samt Brian, der gerade einen 3-Meter-Schutzwall gegen eine Flut stapelt. Eine Flut übrigens, die jeglichen physikalischen Grundsätzen zum Trotz die Rockys völlig überschwemmt, den gerade gestapelten Schutzwall und die dahinter stehenden Häuser jedoch nur bedingt, bevor sie sich wieder zurückzieht. Nicht nur hier zeigt sich übrigens etwas von der Feigheit Brians, die ich eingangs angesprochen habe. Er und seine Kameraden bekommen den Befehl, sich zurückzuziehen, als die Flut immer näher kommt. Sie fliehen (warum andere jedoch vor Ort bleiben oder bleiben müssen und fleißig weiter Sandsäcke wuchten, bleibt offen). Brian regt sich im Zusammenhang mit der Flucht über seine Kameraden auf, denen es scheinbar nichts ausmacht, einen weiteren Kameraden zurückzulassen und diesen dadurch zu verlieren. Macht er selbst etwas? Denkt er etwa daran, ihn zu retten? Dreht er um? Sucht er ihn? Nein. Stattdessen beobachtet er wenig später aus einem Hochhaus andere Soldaten, die immer noch fleißig stapeln und seinen verletzten Kameraden, der verzweifelt versucht, sich noch zu retten, bevor die Flut ihn einholt. Posthum ist er dafür der Einzige, der sich freiwillig um das Grab des entsprechenden Kameraden kümmert.
Ein Beispiel für die fatalistisch stupid wirkende Haltung Brians? Fast gegen Ende der Geschichte wird er von der Gegenseite gefangen genommen. Nach einem Flugzeugabsturz landen er und ein Muslim auf einer Insel im Meer, wo er
sagen wir mal die Erkenntnis gewinnt, dass die Motivation für diesen Krieg auf beiden Seiten nicht stimmen kann. Kurz darauf wird er von der eigenen Armee gefunden und quasi gerettet, wobei ihm nochmals vor Augen geführt wird, die dumm die Menschen sich verhalten. Ändert Brian nach dem eigentlich sehr klärenden Vorfall sein Verhalten? Nein, warum auch? Kaum bekommt er den Befehl, nimmt er die ihm in die Hand gedrückte Waffe und schießt auf alles, was muslimisch sein könnte. Auch seine Rettung ist nebenbei bemerkt kaum zu rechtfertigen. Der Marine egal welcher Armee dürfte es äußerst schwer fallen, sich ohne Karten und Kenntnisse über neu entstandene Untiefen, bzw. auf dem eigentlich doch ziemlich bewegt sein müssenden Ozean, zielgerichtet auf eine bis dahin unbekannte Insel zuzubewegen, um einen einzigen Mann zu retten. Vom Sinn oder Unsinn dieser Rettungsmaßnahme ganz zu schweigen, denn der gleichen Militärführung macht es ja nichts aus, ihn als angeblichen Erlöser in diesem Krieg kämpfen zu lassen.
Der Autor möchte wie er im Nachwort anmerkt bewusst keine Antworten liefern. Wie er auf Seite 222 schreibt, möchte er den Leser dazu bringen, nach einem Besuch in einer fantastischen Welt, die Dinge aus dem Alltag mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es ist zweifellos eine schriftstellerische Kunst, die Gedankenwelt der Leser anzustoßen, mitzureißen, mitdenken zu lassen und letztlich doch dorthin zu führen, wohin der Autor sie haben möchte. Eine noch größere ist es, wenn Leser die so gewonnenen neuen Gedanken in ihren Alltag mitnehmen und gar integrieren, keine Frage. Das Fatale an Klapschus Umsetzung des wirklich guten Grundgedankens ist jedoch, dass sich mir automatisch unzählige Fragen zu fehlender Logik und Konsequenz (wobei ich das Ende selbst hiervon abgrenzen möchte) seiner Geschichte aufdrängen, jedoch kaum eine zu der problematischen Thematik selbst.
Fazit 
Zu viele Denk- und Logikfehler verderben hier leider eine sehr gute Grundidee und einen tatsächlich logisch-konsequenten Schluss. Wirklich schade, denn das passende Cover und die Inhaltsangabe haben auf etwas anderes hoffen lassen. Die von mir hier vergebenen zwei (von fünf) Punkte gibt es für die Idee und die Ausarbeitung des Covermotivs und nicht wirklich für den Inhalt. Das Buch könnte als Jugendbuch durchgehen, wobei ich anmerken möchte, dass der 14jährige Sohn einer Bekannten, der das Buch nur eine Stunde, nachdem ich es aus der Hand legte, in Angriff nahm, sich ebenfalls bereits nach wenigen Kapiteln über die fehlende Logik bestimmter Passagen ausließ.
Copyright © 2011 by Antje Jürgens (AJ)