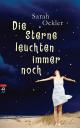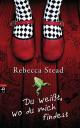Sarah Ockler
Die Sterne leuchten immer noch
Originaltitel: Twenty Boy Summer
aus dem Amerikanischen übersetzt von Bernadette Ott
cbj
ISBN 9783570137499
ISBN 357013749X
Roman Jugendbuch 12 13 Jahre
1. Auflage 2011
Umschlaggestaltung Zeichenpool, München
Gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag, 352 Seiten
[D] 16,99
Was hat Steven Spielbergs E.T. mit Sarah Ockler zu tun? Ganz einfach. Er brachte sie quasi zum Schreiben. Im zarten Alter von sechs Jahren schrieb und illustrierte sie ihr erstes Buch, das an eben diesen Film angelehnt war. Natürlich wurde es nie veröffentlicht. Ihre Eltern ermunterten sie stattdessen, eigene Ideen zu verwirklichen. Diesen Ratschlag hat Sarah Ockler beherzigt. Jahre später, genauer gesagt 2009, erschien ihr Debütroman Twenty Boy Summer, der von den Kritikern gefeiert und von cbj 2011 unter dem Titel Die Sterne leuchten immer noch auf den deutschen Buchmarkt gebracht wurde. Ende 2010 erschien in den USA ihr zweiter Roman unter dem Titel Fixing Delilah.
Die Geschichten und Bücher der Autorin sind vorrangig für Jugendliche geschrieben. Ihre Passion für diese Zielgruppe und All-Age-Leser wurde bei ihrer Arbeit im Lighthouse Writers Workshop Denver verstärkt. Sie unterrichtet dort junge Autoren. Begründet dürfte sie jedoch darin liegen, dass Ockler sich noch gut an ihre Highschool-Zeit erinnern kann. An gute und schlechte, an aufregende und langweilige Tage auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Die Autorin, die den Bachelor of Arts in Communication gemacht hat, verbringt neben dem Schreiben einen Teil ihrer freien Zeit in der Natur und fotografiert gerne diesbezügliche Motive oder Kinder oder geht mit ihrem Ehemann Bergsteigen.
Der Buchumschlag in nachtblau zeigt einen Sandstrand, im Hintergrund etwas Meer, im Vordergrund eine junge Frau bzw. ein junges Mädchen, das in einem weißen Kleid vom Wind umspielt mit ausgebreiteten Armen unter einem sternenklaren Himmel steht. Der Originaltitel passt genauso gut wie die deutsche Übersetzung. Während Twenty Boy Summer an eine Wette angelehnt ist, die die weibliche Hauptfigur Anna mit ihrer Freundin abschließt, deutet der deutsche Titel gleichermaßen auf die Hilflosigkeit wie Hoffnung hin, die Anna empfindet.
Mit fünfzehn sollte man Kribbeln im Bauch spüren. Sich über Schulnoten und die Zukunft Gedanken machen, aber daneben auch über Mode, Make-up, Musik, etc. Sachen erleben, die einen zum Lachen bringen, beste Freunde haben, Träume ausmalen oder Schmetterlinge im Bauch spüren, die mit Verliebtsein oder gar der ersten Liebe einhergehen. Hormonell bedingt ist dieses Alter eine Zeit der emotionalen Tiefs und Hochs in rasanter Abfolge und genau genommen erlebt Anna all dies auch. Bis zu jenem Tag, an dem Trauer und Hilflosigkeit schlagartig überwiegen. Dass ausgerechnet Matt, ihr bester Freund, in den sie seit fünf Jahren verliebt ist, auch nicht erst seit Kurzem etwas für sie empfindet, lässt sie für eine kurze, wundervolle Zeit schweben – bis er völlig überraschend aus dem Leben gerissen wird. Bevor sie irgendjemand von ihrer ersten Liebe berichten kann, endet die zart aufkeimende Beziehung zu dem Jungen, mit dem sie schon ihr ganzes Leben verbracht hat. Noch nicht einmal ihrer besten Freundin, Matts Schwester Frankie, kann sie davon erzählen, denn Matt wollte es seiner Schwester schonend beibringen. Sowohl er als auch Anna hegten die Befürchtung, dass ihre Freundschaft dadurch belastet werden könnte. Deshalb hat er ihr in diesem Zusammenhang das Versprechen abgenommen, niemandem etwas zu sagen, bevor er selbst mit Frankie gesprochen hat. Auch über seinen Tod hinaus fühlt die mittlerweile sechzehnjährige Anna sich an dieses Versprechen gebunden und übernimmt seine Beschützerrolle für seine Schwester. Sie trauert still. Statt selbst Trost zu empfangen, ist sie für Frankie und ihre Eltern da und begleitet sie ein Jahr nach Matts Tod zum ersten Mal an den Ort, an dem die Familie ihre Sommerurlaube verbrachte.
Ockler hat feinfühlig authentisch wirkende Charaktere geschaffen. Ob man nun selbst bereits einmal den Verlust einer nahestehender Person erlebt hat oder nicht – jeder dürfte sich relativ schnell und problemlos in Anna oder eine der anderen Figuren hineinversetzen können. Der Schreibstil der Autorin ist flüssig und locker, ohne flapsig oder aufgesetzt zu wirken. Ihre Darstellung der Gefühle der einzelnen Personen ist nicht überladen, doch geht bisweilen hart an die Grenze. Manchmal möchte man sowohl Frankie als auch Anna fast schütteln, oftmals in die Arme nehmen und trösten.
Die Sterne leuchten immer noch spielt in der Gegenwart und umfasst den Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr, enthält jedoch auch einige länger zurückliegende Erinnerungen. Ein Teil spielt an der Ostküste, der andere an der Westküste der Vereinigten Staaten. Der Raum dazwischen könnte synonym für die Entwicklung der Geschichte stehen, für den Abgrund, der sich nach Matts Tod für seine Familie und Anna zum Rest der Welt aber auch zwischen ihnen auftut. Alles könnte jedoch auch zu einer anderen Zeit an einem völlig anderen Ort stattfinden, denn die Handlung richtet den Blick auf die Emotionen, weniger auf Zeit und Umgebung. Gleichzeitig sind gewisse Passagen enthalten, die typisch amerikanisch gehalten sind, und genau dadurch etwas zu oberflächlich oder lang wirken können. Nach Matts Tod geht jede der Figuren anders mit ihrer Trauer um, wobei die Autorin den Fokus auf Anna richtet, die die Geschichte in Ich-Form erzählt.
Frankie etwa wirkt in ihrem Schmerz egoistisch und oberflächlich, verstockt, kindisch und gleichermaßen verletzend wie verletzlich. Sie verfällt nach einer geschockten Starre in blinden Aktionismus. Zum einen lässt sie kaum jemanden an sich heran, zum anderen scheint ihr neues Leben aus Make-up, Partys und Jungs zu bestehen. In ihrem Schmerz bekommt sie gar nicht mit, dass die Ehe ihrer Eltern zu scheitern droht oder wie es Anna geht.
Annas Welt wird klein, erstarrt eher, während sie Matt durch briefartige Einträge in ihrem Tagebuch am Leben erhält oder erdachte Zwiegespräche mit ihm führt. Durch ihre Erinnerungen lernt man Matt näher kennen. Ockler animiert auch damit zum Nachdenken, zum Schmunzeln, lässt den Leser mitfühlen. Trotz der emotionsgeladenen Thematik schafft es die Autorin, nicht melodramatisch abzurutschen. Sie verbindet geschickt die Gefühle der Trauer und des Schmerzes, der Wut und Hoffnungslosigkeit, aber auch der Verliebtheit, der Hoffnung, der Neugierde und des Verzeihens.
Der gemeinsame Urlaub ist gleichermaßen eine Belastungsprobe für alle, wie auch der Versuch, ein normales Leben zu führen. In diesem Zusammenhang schließen Frankie und Anna vor ihrer Abreise einen Pakt. Die 20 Tage am Meer sollen zum A.B.S.A.Z (absolut bester Sommer aller Zeiten) werden und die Mädchen wollen sie nutzen, jeden Tag einen anderen Jungen kennenzulernen. Einer wird nach Frankies Ansicht schon dabei sein, der Anna um ihre Jungfräulichkeit bringt. Was sich keineswegs einfach gestaltet. Matt ist trotz seines Todes omnipräsent in den Erinnerungen und Gefühlen Annas. Sie trauert nach wie vor und hegt Schuldgefühle, weil sie ihrer Freundin nicht die Wahrheit sagen kann. Den Pakt ist sie nur halbherzig eingegangen, um Frankie aufzumuntern. An eine neue Liebe glaubt sie nicht wirklich; der Gedanke jagt ihr beklemmende Gefühle ein, weil sie glaubt, Matt dadurch zu verraten. Tatsächlich machen sich aber doch Schmetterlinge in ihrem Bauch bemerkbar, als sie Sam kennenlernt. Die Gefühle für ihn, erinnern natürlich an die für Matt, doch gleichzeitig wird deutlich, dass sie andersgeartet sind, weil ihnen eine gewisse Oberflächlichkeit innewohnt. Die Zeit, die sie mit ihm verbringt, und letztlich ihr Tagebuch sorgen jedoch auch dafür, dass ihre Freundschaft zu Frankie auf eine harte Probe gestellt wird.
Gleichwohl ist Ocklers Debütroman jedoch auch voller Hoffnung und, ja auch Kraft. Zeigt nicht nur die traurige Seite etwa durch Annas Erinnerungen. Zeigt, wie wichtig es ist, in solchen Phasen jemanden neben bzw. bei sich zu haben. Dass Schweigen viel zerstören kann und andererseits oft nur wenige Worte vieles aufwiegen. Dass ein kleiner Schritt zur Seite den Betrachtungswinkel verändert. Zeigt, wie wichtig die einzelnen Phasen der Trauer sind. Wie unendlich kostbar Erinnerungen sind und dass man durch Loslassen auch gewinnen kann.
Fazit
Ein Roman über Freundschaft, Liebe, Trauer, Schmerz und das Erwachsenwerden. Hier passt der deutsche Titel perfekt. Die Sterne leuchten immer noch manchmal muss man nur einfach den Kopf heben. Ein Debüt, das berührt und für das ich trotz kleinerer Längen fünf Punkte von fünf Punkten vergeben möchte.
Copyright © 2011 by Antje Jürgens (AJ)