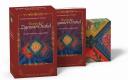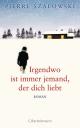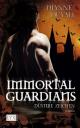Königsfurt-Urania Verlag GmbH
ISBN-13: 9783868267341
ISBN-10: 3868267344
Esoterik
Neuausgabe 2012
Set im Stülpkarton, Buch broschiert, 176 Seiten und 25 Karten
[D] 14,99
Ein Bekannter von mir liest täglich sein Horoskop und ist auch ganz scharf darauf, gegen Jahresende solche für das gesamte folgende Jahr (etwa die in der Fernsehzeitung und diversen Monatszeitschriften) zu studieren. Ich schreibe bewusst studieren, denn wenn man sich hoch konzentriert in die Dinger vertieft, kann man das nicht anders nennen. Dennoch wird er aller Voraussicht nach einen Schreikrampf bekommen, wenn er eine meiner neuesten Errungenschaften mitbekommt. Nach eigenen Aussagen hält er es nämlich eher wie Doris Day in ihrem Song Que sera, sera, wo irgendwo die Textzeile the future’s not ours to see kommt. Esoterische Spinnereien wie Kartendecks oder Pendel kann er deswegen überhaupt nicht ab.
Die Errungenschaft ist ein weiteres Set aus der Bibliothek der Orakel von Königsfurt-Urania. Jedes der Sets ist ein optischer Leckerbissen mit dazu passenden, ausführlichen Informationen und entsprechendem Handwerkszeug (Karten, Pendel, etc.), sodass sowohl Anfänger als auch Geübte damit experimentieren oder arbeiten können. Auch das gerade vor mir liegende Russische Zigeuner-Orakel von Tutschkow ist so gehalten.
Diejenigen, die sich schon länger mit der Materie beschäftigen, werden bei Lesen des Titels Russisches Zigeuner-Orakel vielleicht etwas wie da war doch mal was denken. Ein Buch und Kartendeck von Tutschkow wurde 1991 von HarperOne mit dem Titel Russian Gypsy Fortune Telling Cards herausgegeben. Eine deutsche Ausgabe erschien dann erstmalig 1993, eine weitere 2006 – beide bei AGM Müller AG Urania. Jetzt gibt es die mir vorliegende Neuausgabe aus dem Hause Königsfurt-Urania. Oder vielleicht kennen ja auch einige entsprechende Orakel-Karten von Vadim Tschenze oder die sogenannten Seni Horoskop-Orakelkarten, die auf Wallensteins Hofastrologen und Berater Giovanni Battista Senno, kurz Seni, zurückgehen und als eine der reizvollsten astrologischen Überlieferungen des Abendlandes gelten.
Doch zurück zum aktuellen Set. Das beinhaltet zunächst einmal die 25 quadratischen Karten. Diese messen 10 auf 10 Zentimeter, woran man sich beim Mischen eventuell erst einmal gewöhnen muss. Die Rückseite ist einheitlich schwarz-golden gestaltet und zeigt neben Ornamenten einen mittig angebrachten Stern und in den vier Ecken die Symbole Sonne, Herz, Kleeblatt und Mond. Die farbig gestalteten Vorderseiten sind optisch durch diagonale, ornamentale Streifen (passend zur Rückseite schwarz-golden) geteilt, sodass vier Dreiecke entstehen. Diese Dreiecke sind mit jeweils einem halben Symbol ausgefüllt.
Das Kartenlegen hat etwas von einem Puzzle, bei dem man nach dem Legen durch Drehen versucht, ein Gesamtbild aus zwei nebeneinanderliegenden Hälften herzustellen. Der Legeplatz bleibt dabei derselbe. Grundsätzlich könnten so 50 ganze Symbole entstehen. Praktisch ist das aber nahezu unmöglich. Auch bei diesem Deck kann man die Karten für sich, anwesende oder abwesende Personen legen und deuten, jedoch für ein und dieselbe Person nicht mehr als einmal täglich.
Nur die durch Drehung entstehenden ganzen Bilder werden gedeutet. Hierbei wird dann auch beachtet, ob das Motiv nach links, rechts, oben oder unten zeigt. Wer sich unschlüssig ist, wie er das etwa beim Sonnensymbol erkennen kann, dem wird das Ganze erleichtert. Auf den einzelnen Symbolen findet man einmal Zahlen, die das Nachschlagen im Buch vereinfachen, und Pfeile. Diese befinden sich (in einem kleinen Quadrat, Gold auf Schwarz) in der Mitte der Karten, sodass sie wiederum ein auf Spitze stehendes Quadrat ergeben. Ergeben zwei zusammengehörende Hälften ein ganzes Symbol, findet man die Pfeile dadurch links und rechts oder ober- und unterhalb des desselben.
Die 50 Symbole sind: Kavalier, Kleeblatt, Schiff, Haus, Feuerholz, Apfel, Schlange, Leichenwagen, Blumenstrauß, Sichel, Äste, Vögel, Knabe, Fuchs, Bär, Sterne, reiher, Hund, Burg, Wald, Berge, Straße, Mäuse, Herz, Ring, Buch, Brief, Hufeisen, Geld, Lilie, Sonne, Mond, Fisch, Eule, Anker, Händedruck, Engel, Dame, Pferd, Knoten, Katze, Waage, Krebs, Feuer, Schwein, Brücke, Dämonen, Hahn, Dolch und Brot.
In dem beiliegenden Handbuch wird darauf eingegangen, wofür die 50 Symbole stehen. Wie bei vielen anderen Karten auch ist dank der darauf befindlichen Zahlen ein schnelles Nachschlagen möglich. Die Optik kommt auch im Buch nicht zu kurz. Neben den Abbildungen der Symbole sind die einzelnen Seiten unten mit dem gleichen Ornament verziert, das sich auch auf dem Titelbild oder Stülpkarton findet, zusätzlich weitere Ornamente am Ende jeder Symbolbeschreibung.
Das Handbuch ist in zwei Teile gegliedert: Auf den ersten 30 Seiten finden sich allgemeine Informationen. Etwa über die Herkunft des Orakels, über das Wahrsagen der Zigeuner aber auch über die Geschichte der Familie der Autorin. Dann geht es allgemein um Legung und die innere Einstellung beim Legen.
Im zweiten Teil folgen dann die Symbole im Überblick. Auf jeweils drei Seiten erfährt man ausführlich etwas über die allgemeine und die sich aus der Liegerichtung ergebende Bedeutung und letztlich auch die Dauer des Einflusses. Hierbei hat Swetlana Alexandrowna Tutschkow besonderen Wert darauf gelegt, dass sowohl die russische mystische Seite wie auch die eher vernunftbetonte rationale Seite westlicher Leser nicht zu kurz kommt.
Fazit: Das zur Bibliothek der Orakel gehörende Set Russisches Zigeuner-Orakel ist wieder einmal wunderschön gestaltet und im stabilen Umkarton ebenso praktisch wie ansprechend aufzubewahren. Die Karten selbst heben sich von den üblicherweise erhältlichen Orakelkarten ab. Spannend anders lassen sie sich überraschend und leicht deuten. Das und dazwischen habe ich jetzt bewusst gewählt, weil die Richtigkeit der bisher eingetroffenen Deutungen verblüffend für mich war. Wer Lust hat, Neues auszuprobieren, dem kann ich dieses Set getrost empfehlen, dem ich wieder einmal fünf von fünf Sternen geben möchte.
Copyright © 2012, Antje Jürgens (AJ)